
Karate oder die leere Hand
Wohl kaum eine andere Sportart verbindet so sehr Sport, Kampf, Ästhetik, Kunst und Meditation wie Karate. Der Kampf mit der „leeren Hand“ hat seit vielen Jahren und Jahrzehnten den Breitensport erreicht. Zur Fitness, zum Aufbau der Muskulatur, zur Verbesserung der Haltung, für mehr Konzentration und auch, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, um sich verteidigen zu können. Dabei ist Karate vor allem eines: Eine hohe Kunst. Mit Anspruch an Perfektion, Selbstbeherrschung, Kontrolle und Geduld. Kein Zeitgeist. Kein Konsum. Kein Massensport. Kein Spiel. Sagt der Rödentaler Markus Amberg, lange Jahre Trainer und seit einigen Monaten Autor eines Buches.

Nicole Krauß aus Jagdshof trainiert seit 7 Jahren Karate im Budokan Sonneberg. Für sie ist die fernöstliche Kampfkunst kein Sport, sondern Schule fürs Leben.

Markus Amberg, geboren 1973 in Coburg, Karateka, Träger des 3. DAN, zertifizierter Karatelehrer, A-Trainer und Mental-Trainer in Ausbildung
Markus Amberg liebt und lebt Karate. Seit 1991, als die Leidenschaft in ihm entfacht wurde, noch bevor er ein Jahr später mit 19 beim Fußball umkippte, stundenlang bewusstlos war, danach Sporthose und Trikot dauerhaft gegen den Karateanzug tauschte. Wie viele Jungs dieser Zeit faszinierten ihn Jean-Claude van Damme oder Sylvester Stallone in seinen Rocky-Filmen, die unbändige Kraft, Technik und Disziplin der Filmhelden. Sie waren seine Idole, wie besessen trainierte der Spätberufene Karate, Kraft und Kondition. Die Athletik, die Körperbeherrschung waren seine Ziele. Karate bot eine Vielfalt, eine Komplexität wie kaum eine andere Kampfkunst.
Medienmacht
Karate-do, der Weg (Do) der leeren, der unbewaffneten Hand, stammt ursprünglich aus Okinawa, einer Inselgruppe südlich von Japan. Ursprünglich diente Karate nur dem Kampf, dem Sieg in einer Schlacht, dem Töten mit einem Schlag auf den Solarplexus, die Schläfe oder die Halsschlagader, daraufhin wurden junge Kämpfer trainiert. Wer die Ausführung solcher Schläge heute in einem Verein sucht, wer Karate für den Straßenkampf missbrauchen möchte, ist fehl am Platz. Karate nämlich hat sich zu einer umfassenden Weg-Lehre gewandelt, seit es sich mit chinesischen Traditionen vermischte, bevor es Anfang des 20. Jahrhunderts über Japan in die ganze Welt gelangte. Europa kam Anfang der 1950er Jahre in Berührung mit der fernöstlichen Kampfkunst, als Karate in Paris gelehrt wurde. Ein deutscher Judoka brachte den Sport schließlich in die Bundesrepublik, wo er sich Anfang der 1960er Jahre emanzipierte. Vor allem in den 1970er bis 1990er Jahren war Karate in Deutschland sehr beliebt, begünstigt auch durch den Hype um den chinesisch-amerikanischen Filmhelden Bruce Lee, dessen Mutter eine Deutsch-Chinesin war, einer der Stars der Kampfkunstszene, der, obwohl schon mit 32 verstorben, eine Fülle an Filmen produzierte und zum Idol einer ganzen Generation wurde. Heute zählt der Deutsche Karate Verband etwa 100 000 Mitglieder.
Gürtelinflation
Doch um diesen Trend hin zum Breitensport tobt ein Glaubenskampf. Markus Amberg zitiert gerne den höchsten Karateka-Meister Europas Fritz Nöpel mit den Worten: „Man darf Karate eigentlich nicht als Breitensport betreiben.“ Entweder, so auch der Standpunkt Ambergs, ist Karate eine Kampfkunst, oder Karate ist durch Gürtelprüfungen und Wettkämpfe leistungsorientiert, dann ist es ein Leistungssport. Die vielen Gürtel aber, die mit ihren Farben ja immerhin Aussagen treffen über beherrschte Techniken, werden heute „fast inflationär“ vergeben, „es kann aber nun mal nicht jeder Meister sein und einen schwarzen Gürtel tragen“, kritisiert Amberg. Außerdem könnten sich die wenigsten Breitensportler heute mit ihren Techniken im Ernstfall wirklich einmal selbst verteidigen, sagt er. Auch wenn schon das Wissen um die Beherrschung der Technik an sich reichen sollte, um im Bedrohungsfall einen Gegner auf Distanz zu halten.
» Wer Karate für den Straßenkampf missbrauchen möchte, ist fehl am Platz «
Glücksgefühle
Karate lebt vor allem von Schlag-, Stoß-, Tritt-, Block- und Fußfegetechniken, erfordert Kondition, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Achtsamkeit, Konzentration und viel Geduld. Ein langer, ein anstrengender Weg mit viel Quälerei, Selbstüberwindung, so gar nicht dem aktuellen Lifestyle entsprechend, kein Sport zum kurzen abendlichen Auspowern, eine Kampfkunst eben, aber vielleicht genau daher so interessant, weil sie den Blick nach innen öffnet, auf die eigenen Widerstände, die eigenen Grenzen. Die zu überwinden, sich abzuhärten, Schmerzen zu ertragen, das treibt auch Amberg an. „Gerade das bringt ja Glücksgefühle“, sagt er. Dann wird Karate zur Meditation, zur Kunst, dann gerät man im besten Fall in einen Flow, man tritt aus sich heraus, beobachtet die eigene Perfektion, alles läuft wie von selbst. „Karate ist Coaching fürs Leben, kein bloßer Sport“, sagt Markus Amberg.
» Karate ist Coaching fürs Leben, kein bloßer Sport «
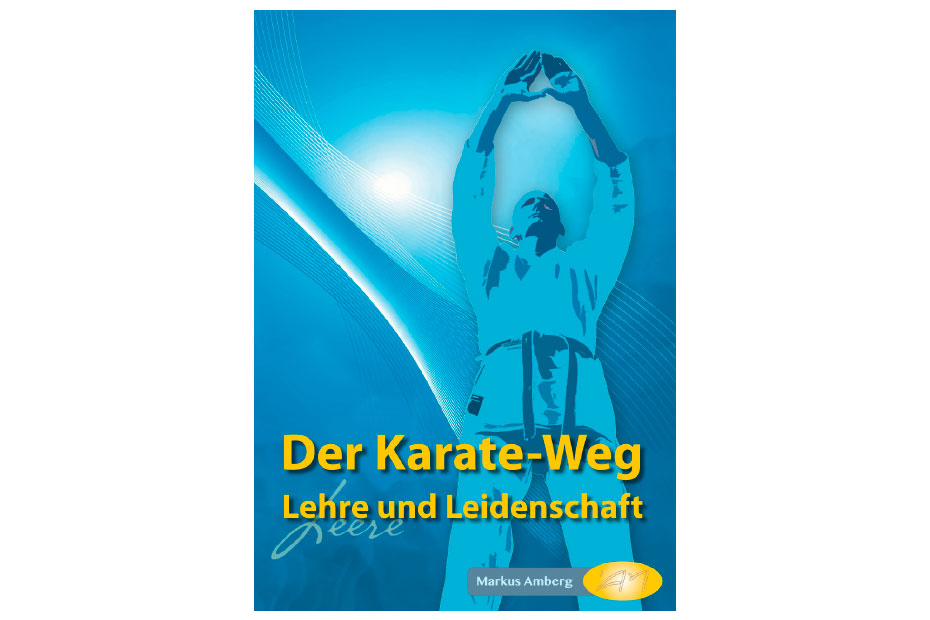
Markus Amberg: Der Karate-Weg – Lehre und Leidenschaft. Zu bestellen über www.my-power-energy.de.
von Wolfram Hegen
Fotos Sebastian Buff
Gefällt mur sehr gut dieser Bericht, mache selbst seit 2009 Karate und sehe es genauso. Besonders die “ Gürtelvergabe“, manchmal ein Graus.
Schade, dass ich das Magazin, nicht im Original lesen kann.
Gruß aus München